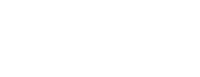Sozial und umweltverträglich investieren und mit gutem Beispiel im eigenen Unternehmen vorangehen – das ist Kern unseres Handelns und fest in den Werten der AIF Capital verankert. Damit wollen wir natürliche Ressourcen schonen, zum Umweltschutz beitragen und für einen starken Zusammenhalt in der Gesellschaft einstehen.
Hierzu entwickelt die AIF Capital Group derzeit eine umfassende ESG-Strategie, die für alle Unternehmensbereiche gilt.
Gemeinsam Verantwortung übernehmen.
Wir setzen schon jetzt Maßnahmen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung um:
AIF Capital prüft ESG-Kriterien bei jedem neuen Investment. Die Immobilien werden klimaeffizient geplant und errichtet. Barrierefreiheit ist nicht nur in unseren Sozialimmobilien, sondern in allen Gebäuden Standard.
Investmentfonds werden auf ESG-Kriterien geprüft – eine Anforderung, die regulierte Investoren zurecht an unsere Produkte stellen.
Wir belohnen ökologisch nachhaltiges Verhalten im Unternehmen – eine Prämie für Mobilität und Umwelt ist in jedem Arbeitsvertrag unserer Mitarbeitenden fester Bestandteil.
Bahn zuerst: Für Geschäftsreisen ist die Bahn das Verkehrsmittel der ersten Wahl. Wir vermeiden Individualverkehr.
Alle Mitarbeitenden werden speziell zu ESG geschult.
Im Unternehmen leben wir Diversität. Gender und Background spielen durch objektive Leistungsbewertung keine Rolle.
Wir legen Wert auf Gesundheit und sozialen Ausgleich. Events für unsere Mitarbeitenden und Sportangebote spielen eine wichtige Rolle für den sozialen Zusammenhalt im Unternehmen.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Artikel 3-5 Offenlegungsverordnung SFDR)
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei unseren Investitionsentscheidungen
Gemäß der EU-Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die Sustainable Finance Disclosure Regulation «SFDR») müssen Finanzmarktteilnehmer ihre Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei ihren Investitionsentscheidungsprozessen offenlegen.
Ein Nachhaltigkeitsrisiko ist ein Ereignis oder eine Bedingung aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), das bei Realisierung, einen tatsächlichen oder potenziellen wesentlichen negativen Einfluss auf den Wert der getätigten Investitionen haben kann („Nachhaltigkeitsrisiko“). Das Nachhaltigkeitsrisiko wirkt sich dabei auf die bekannten Risikoarten aus.
Nachhaltigkeitsrisiken werden bei der AIF Kapitalverwaltungs-AG in die Investitionsentscheidung und Risikoüberwachung einbezogen. Dies erfolgt innerhalb des gesamten Investitionsprozesses, sowohl in der fundamentalen Analyse als auch in der Anlageentscheidung und der laufenden Überwachung. Dafür erhebt die AIF Kapitalverwaltungs-AG gemeinsam mit ihren Serviceprovidern nach Verfügbarkeit Verbrauchsdaten in ihren Immobilien und bezieht Daten zu physischen Risiken von einem etablierten Provider.
Die Betroffenheit, Wahrscheinlichkeit und Schwere von Nachhaltigkeitsrisiken unterscheidet sich je nach Region und Immobilie. Deshalb berücksichtigt die AIF Kapitalverwaltungs-AG die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen des Anlageprozesses. Nachhaltigkeitsrisiken, welche sich aus der Analyse der ESG-Kriterien ergeben, werden mit Blick auf ihre finanzielle Wirkung kontinuierlich analysiert und bei der Bewertung der Ertrags- und Risikoeinschätzung berücksichtigt. Dies erfolgt sowohl bei der Analyse potentieller Anlagemöglichkeiten als auch in der laufenden Überwachung der vorhandenen Bestandsinvestitionen. Physische Risiken reduziert die AIF Kapitalverwaltungs-AG durch den Abschluss von Versicherungen. Transitorische Risiken werden laufend – je nach Verfügbarkeit – über Verbrauchsdaten der Immobilien analysiert. Sehr hohe Risiken können durch bauliche Maßnahmen reduziert oder die Immobilie im Zweifelsfall veräußert werden.
Transparenz nachteiliger Auswirkungen auf Unternehmensebene
Die AIF Kapitalverwaltungs-AG betrachtet zur Wahrung der Sorgfaltspflicht bei jeder Investitionsentscheidung die mit diesen zusammenhängenden, wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt, Soziales, Arbeitnehmerrechte, Menschenrechte, Korruption, Bestechung und Unternehmensführung).
Gleichzeitig werden im Rahmen der Investitionsentscheidungen die Indikatoren für die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeit betrachtet. Dabei werden wie im Folgenden dargestellt neben den verpflichtenden Indikatoren weitere optionale Indikatoren berücksichtigt: Als Haupttreiber von Nachhaltigkeitsrisiken der Vermögensgegenstände unserer Fonds sehen wir energieineffiziente Immobilien an. Als weiteren Treiber sehen wir die Nutzung fossiler Brennstoffe im Rahmen der Bewirtschaftung der Immobilien an. Als weitere Nachhaltigkeitsrisiken sehen wir die Energieverbrauchsintensität, den Anteil des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energieträger, das Angewiesensein auf Unternehmen der Nutzung fossiler Brennstoffe, das Hinterlassen des sogenannten „Carbon Footprints“ sowie die Verursachung von Treibhausgasemissionen. Abschließend und optional sehen wir – in umweltökonomischer Hinsicht – den Verbrauch von Rohmaterial für Neukonstruktionen und Renovierungen größeren Ausmaßes sowie – in sozialer Hinsicht – den nichtausreichenden Schutz von Hinweisgebern (sog. Whistleblowern) als zu berücksichtigen im Rahmen von Investitionsentscheidungen unserer Fonds. Sollten hierbei Schwellenwerte überschritten werden, führt dies zum Ausschluss im Rahmen der Anlageentscheidung, zu baulichen Maßnahmen oder zum Verkauf der Immobilie.
Durch die Berücksichtigung der nachteiligen Auswirkungen im Rahmen einer Investitionsentscheidung wird sichergestellt, dass das Anlageziel des Finanzprodukts nicht durch nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsbereiche erreicht wird.
Da die AIF Kapitalverwaltungs-AG nahezu ausschließlich in Immobilien investiert, kann eine aktive Mitwirkung zur Reduzierung der nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeit nicht erfolgen. Gleichzeitig werden im Rahmen von Verbrauchsdaten bei energieineffizienten Gebäuden kontinuierlich bauliche Maßnahmen diskutiert, die zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs führen können.
Transparenz nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Ebene des Unternehmens
Die AIF Kapitalverwaltungs-AG betrachtet zur Wahrung der Sorgfaltspflicht bei Investitionsentscheidungen die mit diesen zusammenhängenden, wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt, Soziales, Arbeitnehmerrechte, Menschenrechte, Korruption, Bestechung und Unternehmensführung). Die Berücksichtigung der wichtigsten negativen Auswirkungen ist für die einzelnen Fonds nicht verbindlich, es sei denn, solche Verpflichtungen bilden die Anlagestrategie, die den Präferenzen der Anleger unterliegt. Eine Teilmenge der von der Gesellschaft verwalteten Fonds mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit kann verbindliche Verpflichtungen in Bezug auf Nachhaltigkeitsfaktoren enthalten, während andere Fonds negative Auswirkungen aus einer risikoorientierten Perspektive überwachen.
Dazu werden im Rahmen der Investitionsentscheidungen Indikatoren der Offenlegungsverordnung (SFDR) für die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeit betrachtet. Im Folgenden finden Sie unsere vollständige Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für den Zeitraum:
Transparenz der Vergütungspolitik im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken
Im Rahmen der Geschäftsstrategie der AIF Kapitalverwaltungs-AG sind ökologische, soziale und auf verantwortungsvolle Unternehmensführung bezogene Kriterien verankert. Im Rahmen der Investitionsentscheidung und Anlageberatung werden Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt. Gleichzeitig wird im Rahmen der Vergütungspolitik sichergestellt, dass die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Weise bewertet wird, die ein Handeln im bestmöglichen Interesse der Kundinnen und Kunden sicherstellt. Hierbei erfolgt eine Einteilung in einem persönlichen Zielbonus in Höhe von 75 % des Gesamtzielbonus und einem Unternehmensbonus in Höhe von 25 % des Gesamtzielbonus. Die persönlichen Ziele und ihre Gewichtung werden jährlich, i.d.R. bis zum 28.02. zwischen der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter und der Führungskraft in Textform vereinbart. Zum Jahresende wird der Zielerreichungsgrad in einem gemeinsamen Gespräch festgelegt. Die vereinbarten Ziele werden bei Bedarf angepasst. Die AIF Kapitalverwaltungs-AG stellt für alle Mitarbeiter durch einen regelmäßigen Wissensaustausch und die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen eine ganzheitliche Berücksichtigung der Compliance-Themen im Bereich der Nachhaltigkeitsrisiken sicher, die individuell in der Zielvereinbarung dokumentiert und für die Zielerreichung relevant sind.
Ergänzende Hinweise zur Vergütungspolitik
Vergütungspolitik der AIF Kapitalverwaltungs-AG (Kapitalverwaltungsgesellschaft)
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat für alle ihre Mitarbeiter ein Vergütungssystem in Übereinstimmung mit § 37 KAGB und Anhang II der Richtlinie 2011/61/EU (AIFM-Richtlinie) festgelegt, das mit einem soliden und wirksamen Risikomanagementsystem vereinbar und diesem förderlich ist. Das Vergütungssystem gilt insbesondere auch für den Vorstand, Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der verwalteten Investmentvermögen haben (Risikoträger), Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.
Zielsetzung der Vergütungspolitik der Kapitalverwaltungsgesellschaft ist neben der Erfüllung regulatorischer Vorgaben die Förderung eines nachhaltigen und risikobewussten Verhaltens der Mitarbeiter und die Ausrichtung am Geschäftsmodell, am nachhaltigen Erfolg und an der Risikostruktur der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Zentrales Element der Vergütungspolitik ist ferner die konsequente Ausrichtung des Vergütungssystems an den ethischen Grundsätzen der Kapitalverwaltungsgesellschaft.
Gleichzeitig sollen Leistung belohnt und motivierte Mitarbeiter an das Unternehmen langfristig gebunden werden. Dabei werden jedoch ausdrücklich keine Anreize gesetzt, die zum Eingehen von Risiken verleiten und die nicht mit dem Risikoprofil, den Anlagebedingungen oder dem Gesellschaftsvertrag der von ihr verwalteten Investmentvermögen vereinbar sind. Ferner werden keine Anreize gesetzt, welche die Kapitalverwaltungsgesellschaft daran hindern könnten, pflichtgemäß im besten Interesse des jeweiligen Investmentvermögens zu handeln. Die Vergütungspolitik der Kapitalverwaltungsgesellschaft befindet sich insofern im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen.
Die Vergütung der Mitarbeiter setzt sich aus einer fixen Vergütung sowie einer variablen Komponente zusammen. Die Dienstverträge der Geschäftsleiter sehen als qualitative Leistungsindikatoren der variablen Vergütung das Erfüllen von Anforderungen des Aufsichtsrechts sowie ein Abstellen auf die Einhaltung der Offenlegungsverordnung- und/oder Taxonomieverordnungsrelevanten Faktoren der Anlagestrategien während des Referenzjahres der variablen Vergütung vor. Diese Leistungsindikatoren werden auf die Mitarbeiter herunterkaskadiert. In besonderen Einzelfällen können Mitarbeiter weitere Bonifikationen erhalten. Im Einzelnen gilt für die einzelnen Vergütungskomponenten Folgendes:
- Das Jahresfestgehalt wird in zwölf gleichen, monatlichen Beträgen ausbezahlt. Die Höhe der festen Vergütung bestimmt sich dabei nach der Wertigkeit der ausgeübten Funktion und entsprechend den Marktgegebenheiten. Die fixe Komponente ist so bemessen, dass für die Mitarbeiter keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung entsteht
- Die auf Jahresbasis bemessene variable Vergütung bemisst sich in Abhängigkeit der Unternehmensentwicklung und individuellen Zielerreichungen. Sie darf in der Regel nicht mehr als 100 % der fixen Vergütung betragen. Die Auszahlung der variablen Vergütung erfolgt nach Feststellung des individuellen Zielerreichungsgrades, der Feststellung des Jahresabschlusses der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Genehmigung des zur Auszahlung zur Verfügung stehenden Bonustopfs durch den Aufsichtsrat. Die Feststellung des zur Verteilung stehenden Bonustopfs erfolgt im Rahmen der Budgetplanung für das jeweils folgende Geschäftsjahr.
- In besonderen Einzelfällen können Mitarbeiter über die variable Vergütung hinaus weitere Bonifikationen erhalten (z.B. bei Erreichung besonderer Ziele); derartige Nebenleistungen sowie deren Voraussetzungen unterliegen in jedem Fall einer gesonderten Vereinbarung, auf deren Abschluss der Mitarbeiter jedoch keinen Anspruch hat.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat von der – aufgrund ihrer Größe – fakultativen Möglichkeit, einen Vergütungsausschuss einzurichten, keinen Gebrauch gemacht.
Konkrete Informationen zu den jährlichen Vergütungen, die an die Geschäftsleiter und andere Risikoträger gezahlt werden, werden in den Jahresabschlüssen bzw. Jahresberichten der Fonds ausgewiesen.
Richtline zur Vermeidung von Interessenkonflikten und über den Umgang mit Interessenkonflikten
Inhaltsverzeichnis
- Zielsetzung der Richtlinie
- Geltungsbereich der Richtlinie
- Ermittlung von Interessenkonflikten
- Vorbeugung von Interessenkonflikten
- Organisatorische Vorkehrungen
- Administrative Maßnahmen
- Beauftragter zur Vermeidung von Interessenkonflikten
- Beilegung und Beobachtung von Interessenkonflikten
- Offenlegung von Interessenkonflikten
- Maßnahmen bei Verstößen gegen die Richtlinie
- Weiterentwicklung der Richtlinie
§ 1 Zielsetzung der Richtlinie
Als Kapitalverwaltungsgesellschaft i.S.d. §§ 20, 22 KAGB ist die AIF Kapitalverwaltungs-AG, auch als AIF Partner KVG bezeichnet (nachfolgend „KVG“), verpflichtet, ihre Tätigkeit ehrlich, redlich und mit der gebotenen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit auszuüben und dabei im besten Interesse der von ihr verwalteten Investmentvermögen und der Anleger der Investmentvermögen sowie im Interesse der Integrität des Marktes zu handeln. Soweit daher bei der Verwaltung von Investmentvermögen (nachfolgend „AIF“ – Alternative Investment Fund) potentielle oder tatsächliche Interessenkonflikte im Sinne des § 27 KAGB auftreten, hat die KVG sicherzustellen, dass diese Interessenkonflikte auf faire Weise im Sinne der Anleger und Kunden gehandhabt werden. Damit dies gelingt, hat die KVG in der vorliegenden Richtlinie geeignete Maßnahmen zu ihrer Identifizierung und Handhabung festgelegt.
§ 2 Geltungsbereich der Richtlinie
- Wo immer sich geschäftliche Interessen gegenüberstehen, kann es zu Interessenkonflikten kommen. Von dieser Richtlinie erfasst, sind aber nur solche Interessenkonflikte, die zu einem Schadensrisiko für die Kunden oder die Anleger eines von der KVG verwalteten AIF führen können („potentieller Interessenkonflikt“) oder tatsächlich führen („tatsächlicher Interessenkonflikt“).
- Die Richtlinie gilt unmittelbar für die Mitglieder der Geschäftsleitung der KVG sowie für sämtliche Mitarbeiter der KVG.
- Die Mitglieder der Geschäftsleitung der KVG sind dafür verantwortlich, dass die Bestimmungen dieser Richtlinie auch zu beachten sind von
- Auslagerungsunternehmen, deren Geschäftsleitungsmitgliedern und allen mit der ausgelagerten Tätigkeit befassten Mitarbeiter
und /oder
- jeder anderen natürlichen oder juristischen Person, die im Rahmen einer Vereinbarung zur Übertragung von Aufgaben an Dritte unmittelbar an der Erbringung von Dienstleistungen für die KVG beteiligt ist, die der KVG die gemeinsame Portfolioverwaltung ermöglichen.
§ 3 Ermittlung von Interessenkonflikten
Beteiligte eines Interessenkonflikts
1. Interessenkonflikte sind bei der Verwaltung von AIF u.a. denkbar
- zwischen der KVG sowie ihren Führungskräften, Mitarbeitern oder jeder anderen Person, die über ein direktes oder indirektes Kontrollverhältnis mit der KVG verbunden ist, und dem von ihr verwalten AIF oder den Anlegern dieses AIF;
- zwischen dem ggf. von der KVG beauftragten Auslagerungsunternehmen, seinen Führungskräften, Mitarbeitern oder jeder anderen Person, die über ein direktes oder indirektes Kontrollverhältnis mit dem Auslagerungsunternehmen verbunden ist, und dem von der KVG verwalten AIF oder den Anlegern dieses AIF;
- zwischen dem von der KVG verwalteten AIF oder den Anlegern dieses AIF und einem anderen von der KVG verwalteten AIF oder den Anlegern jenes AIF;
- zwischen dem von der KVG verwalteten AIF oder den Anlegern dieses AIF und einem anderen Kunden der KVG;
- zwischen zwei Kunden der KVG.
2. Gegenläufige Interessen
Ein Interessenkonflikt ist insbesondere dann indiziert, wenn folgende Situation vorliegt:
- Erzielung eines finanziellen Vorteils der KVG, eines Auslagerungsunternehmens oder einer der in § 2 genannten Personen zu Lasten des AIF bzw. seiner Anleger;
- Interesse am Ergebnis einer für den AIF erbrachten Leistung der KVG, eines Auslagerungsunternehmens oder einer der in § 2 genannten Personen, das nicht mit den Interessen der Anleger des von der KVG verwalteten AIF an diesem Ergebnis übereinstimmt;
- Vermeidung eines finanziellen Verlustes der KVG, eines Auslagerungsunternehmens oder einer der in § 2 genannten Personen zu Lasten des AIF bzw. seiner Anleger;
- die Interessen der KVG, eines Auslagerungsunternehmens oder einer der in § 2 genannten Personen an der für den AIF erbrachten Dienstleistung sind – abgesehen von der Vergütung – nicht deckungsgleich mit den Interessen des AIF;
- Begünstigung der Interessen eines einzelnen Anlegers, einer Anlegergruppe oder eines anderen AIF zu Lasten des von der KVG verwalteten AIF;
- zeitgleiche Ausführung einer identischen Tätigkeit für mehrere AIF;
- Bestehen eines finanziellen oder sonstigen Anreizes, die Interessen eines AIF über die Interessen eines anderen, ebenfalls von der KVG verwalteten AIF zu stellen;
- Vereinnahmung einer Vergütung von einer dritten Person im Rahmen der Portfolioverwaltung.
3. Interessenkonfliktbeispiele
Beispielhaft für typische Interessenkonflikte sind folgende Situationen:
- a) Interessenkonflikte zwischen KVG und einer der in § 2 genannten Personen einerseits und / oder Anlegern andererseits
- Die KVG beauftragt ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine der in § 2 genannten Personen mit einer Dienstleistung im Rahmen des Geschäftsbetriebs des AIF, wie z.B. das Asset-Management einer Immobilie.
- Die KVG investiert für die von ihr verwalteten AIF in Investitionsobjekte, die einer mit ihr verbundenen Gesellschaft oder einer der in § 2 genannten Personen gehören.
- Die KVG beauftragt einen Investitionsberater für die Auswahl von Investitionsmöglichkeiten (z.B. für Investitionen in andere Fonds), die eine der in § 2 genannten Personen oder ein mit der KVG verbundenes Unternehmen ist.
- Die prozentuale Geschäftsbesorgungsvergütung der KVG bestimmt sich nach der Höhe des eingesammelten Kapitals des AIF („hartes Cap beim Fundraising“).
- Die Laufzeit des von der KVG verwalteten AIF wird ohne erkennbaren Vorteil zugunsten der Anleger verlängert, um weitere Gebühren vereinnahmen zu können.
- Der AIF beteiligt sich mit Kapital an einem Zielunternehmen. Diese Beteiligung wird durch die Gewährung eines Darlehens von einer der in § 2 genannten Personen oder von einer Person finanziert, die in einem direkten oder indirekten Abhängigkeitsverhältnis zu der KVG steht. Die KVG hat eine Investition in ein Zielunternehmen getätigt und erhält von diesem eine laufende Vergütung.
- Die KVG oder eine der in § 2 genannten Personen erhalten Geschenke oder Einladungen von nicht lediglich geringfügiger Art, die geeignet sind, ihr Verhalten in einer den Interessen der Anleger des verwalteten AIF widersprechenden Weise zu beeinflussen,
- Eine der in § 2 genannten Personen investiert ggf. zu Vorzugskonditionen in von der KVG verwaltete AIF oder tätigt Geschäfte mit diesen.
- b) Interessenkonflikte zwischen mehreren AIF
- Eine KVG oder ein Auslagerungsunternehmen setzt, bevor ein erster AIF voll platziert ist, einen zweiten AIF mit einer vergleichbaren Investitionsstrategie auf. Soweit Investitionsentscheidungen zu treffen sind, hat die KVG zu entscheiden, für welchen der beiden AIF die Investition ausgeführt werden soll.
- Die KVG verwaltet gleichzeitig zwei AIF, zwischen denen eine Geschäftstätigkeit zum Vorteil des einen und zum Nachteil des anderen AIF ausgeführt wird.
- Bei der Verwaltung von mehreren AIF setzt die KVG Personal eines AIF für einen anderen AIF ein.
- c) Interessenkonflikte zwischen Anlegern
Die KVG räumt einem einzelnen Anleger besondere Investmentrechte ein, die den anderen Anlegern eines AIF nicht zustehen.
- d) Interessenkonflikte zwischen Kunden
Die KVG vermittelt den Kauf und Verkauf von Anteilen an von ihr verwalteten AIF zwischen zwei Kunden und wird dadurch für zwei Kunden mit entgegenlaufenden Interessen tätig.
§ 4 Vorbeugung von Interessenkonflikten
- Um der Entstehung von Interessenkonflikten vorzubeugen, haben die in § 2 genannten Personen, hohe Standards einzuhalten. Diese umfassen jederzeit rechtmäßiges und professionelles Handeln sowie die Wahrung der allgemeinen Marktregeln, wobei stets die Interessen der Anleger zu beachten sind.
- Die zu treffenden organisatorischen Vorkehrungen und administrativen Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten richten sich unter Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes an der Größe und Organisation der KVG und der Art, dem Umfang und der Komplexität ihrer Geschäfte aus. Sicherungsmaßnahmen zur Vorbeugung von Interessenkonflikten müssen angemessen und wirksam sein.
- Die Geschäftsleitung der KVG bzw. die Geschäftsleitung eines von ihr beauftragten Auslagerungsunternehmens hat sicherzustellen, dass die betroffenen Personen, diejenigen Verfahren, die für eine ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Pflichten notwendig sind, kennen und beherrschen.
§ 5 Organisatorische Vorkehrungen
Zur Vermeidung von Interessenkonflikten ist zu gewährleisten, dass die in § 2 genannten Personen ihre Geschäftstätigkeit unabhängig ausüben und dabei potenzielle Risiken für die AIF und deren Anleger beachten. Hierzu wurden folgende Vorkehrungen getroffen:
- Unabhängigkeit
Die KVG bzw. das ggf. von ihr beauftragte Auslagerungsunternehmen führt ihre Geschäftsaktivitäten unabhängig von Interessen Dritter und Weisungen der Gesellschafter aus, insbesondere wird auf den Abschluss von Beherrschungsverträgen zwischen der KVG und der Konzernmutter verzichtet sowie auch sonst eine Einflussnahme auf das unabhängige Management der KVG innerhalb des Konzerns vermieden; - Unabhängigkeitserklärung
Unterzeichnung der in der Anlage zu dieser Richtlinie beigefügten Unabhängigkeitserklärung durch die Mitglieder der Geschäftsleitung der KVG und ggfs. eines Auslagerungsunternehmens; - Funktionstrennung
Funktionale und räumliche Trennung der verschiedenen Geschäftsbereiche, insbesondere zwischen Portfolioverwaltung und Compliance, Kontrollsystemen und Risikomanagement sowie Trennung von Aufgaben und Verantwortungsbereichen in Bezug auf eigene Betriebsabläufe, die als miteinander unvereinbar anzusehen sind oder potentiell systematische Interessenkonflikte hervorrufen können; - Mitarbeitervergütungspolitik
Festlegung einer Mitarbeitervergütungspolitik entsprechend den regulatorischen Vorgaben, die gewährleistet, dass die in § 2 genannten Personen ihren Anreiz in der Wertentwicklung sämtlicher von ihnen verwalteter AIF sehen, wodurch einer Bevorzugung einzelner AIF oder Kunden entgegengewirkt wird; - Chinese Walls
Errichtung von Vertraulichkeitsbereichen und Informationsbarrieren mit virtuellen bzw. tatsächlichen Barrieren (sog. „Chinese Walls“) zur Beschränkung des Informationsflusses, insbesondere Implementierung von Zugriffsberechtigungen; - Mitarbeitergeschäfte-Richtlinie
Implementierung von Verhaltensrichtlinien und Verfahren für Mitarbeitergeschäfte; - Zuwendungsrichtlinie
Implementierung von Verhaltensrichtlinien und Verfahren über die Annahme von Geschenken und sonstigen Vorteilen durch die KVG oder durch einer der in § 2 genannten Personen; - Institutionalisierte Interessenkonfliktabfrage
Das Portfoliomanagement hinterfragt jeweils vor Durchführung der relevanten Maßnahme das Vorhandensein eines Interessenkonflikts und zwar - bei Gründung eines neuen AIF
- bei Erwerb und Veräußerung von Vermögensgegenständen durch einen AIF
- bei sonstigen Investitionsentscheidungen
- bei Verwaltungsmaßnahmen
- bei einer Tätigkeit einer Person für mehrere AIF („Mehrfachtätigkeit“).
§ 6 Administrative Maßnahmen
Zur Vermeidung von Interessenkonflikten hat die Geschäftsleitung der KVG bzw. ein von ihr beauftragtes Auslagerungsunternehmen folgende administrative Maßnahmen zu treffen:
- Etablierung von Verfahren zur Ermittlung und Beilegung von Interessenkonflikten, Anweisung zu ihrer unbedingten Einhaltung und Überwachung der Einhaltung;
- Überwachung der Einhaltung der Verhaltensrichtlinien und der Verfahren zum Umgang mit Interessenkonflikten durch die Interne Revision und die Compliance-Funktion;
- Angemessene Dokumentation der Leistungen und Aktivitäten der KVG bzw. ihrer Geschäftsführung, der Mitarbeiter und der in § 2 genannten Personen, jeweils in den Fällen, in denen ein Interessenkonflikt ermittelt wurde;
- Bei Investitionsmöglichkeiten, die für mehrere AIF mit gleicher Investitionsstrategie in Betracht kommen, wird die KVG die Investitionsgelegenheit unter Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes aller in Frage kommenden von ihr verwalteten AIF zu denselben Konditionen anbieten und bei Investitionsinteresse von mehreren von ihr verwalteten AIF, die Investitionsgelegenheit auf die interessierten AIF aufteilen oder bei Unaufteilbarkeit ein geeignetes Zuteilungsverfahren (Rotationsverfahren oder das Zufallsprinzip /Los-Verfahren) anwenden und entsprechend dokumentieren;
- Soweit es die angemessene Beilegung bzw. Beobachtung eines Interessenkonfliktes erfordert, können die in § 2 genannten Personen zur Beendigung ihrer Arbeit an einer spezifischen Geschäftsaktivität oder ihrer Teilnahme an dem Management zur Beilegung eines potenziellen Interessenkonfliktes aufgefordert werden;
- Schulung aller betroffenen Mitarbeiter der KVG bzw. der von ihr beauftragten Auslagerungsunternehmen und der weiteren in § 2 genannten Personen.
§ 7 Beauftragter zur Vermeidung von Interessenkonflikten
- Die Geschäftsleitung der KVG hat einen Beauftragten zur Vermeidung von Interessenkonflikten benannt, der dieser direkt unterstellt ist.
- Dem Interessenkonflikt-Beauftragten obliegen die Entgegennahme und Prüfung von Meldungen nach § 8 dieser Richtlinie.
- Der Interessenkonflikt-Beauftragte hat dafür Sorge zu tragen, dass die von dieser Richtlinie betroffenen Personen über diese grundsätzlich informiert und regelmäßig geschult werden.
- Darüber hinaus obliegt es dem Interessenkonflikt-Beauftragten, die Einhaltung dieser Richtlinie regelmäßig zu kontrollieren.
- Der Interessenkonflikt-Beauftragte erstattet unmittelbar der Geschäftsleitung regelmäßig, mindestens jährlich Bericht über die Wahrnehmung seiner Aufgaben.
§ 8 Beilegung und Beobachtung von Interessenkonflikten
- Interessenkonflikte sind unverzüglich anzuzeigen sowie auf faire Weise zu handhaben und beizulegen.
- Jede der in § 2 genannten Personen ist daher verpflichtet, dem Interessenkonflikt-Beauftragten unverzüglich diejenigen Tatsachen anzuzeigen, die auf das Vorliegen einer Interessenkonfliktsituation im Sinne des § 2 Abs. 1 dieser Richtlinie hinweisen.
- Der Interessenkonflikt-Beauftragte prüft, ob der vorgetragene Sachverhalt auf eine Interessenkonfliktsituation im Sinne des § 2 Abs. 1 dieser Richtlinie hindeutet. Sofern dies der Fall ist, hat er die Geschäftsleitung der KVG über Art und Umfang des Interessenkonfliktes unverzüglich zu informieren und dies entsprechend zu dokumentieren.
- Die Bewertung und Behebung des Interessenkonflikts erfolgt sodann durch die Geschäftsleitung der KVG.
- Soweit die bestehenden und laufenden Maßnahmen nicht geeignet oder nicht ausreichend sind, um einen Interessenkonflikt beizulegen, hat die Geschäftsleitung der KVG zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, wie beispielsweise:
- gewissenhafte Prüfung aller zur Verfügung stehenden Maßnahmen und Implementierung von AIF-spezifischen Informationsrestriktionen oder anderen zusätzlichen Maßnahmen zur Informationstrennung;
- Übertragung des Interessenkonflikt-Managements auf eine übergeordnete Managementebene, die verantwortlich für die Geschäftsstrategie der KVG ist und die möglichen Risiken einzuschätzen vermag;
- Beendigung der Aktivität.
§ 9 Offenlegung von Interessenkonflikten
- Die KVG ist verpflichtet, die Anleger über Interessenkonflikte in Kenntnis zu setzen, sobald sich herausstellt, dass die von der KVG getroffenen organisatorischen Maßnahmen zur Ermittlung, Vorkehrung, Beilegung und Beobachtung von Interessenkonflikten nicht ausreichen, um nach vernünftigem Ermessen zu gewährleisten, dass das Risiko einer Beeinträchtigung von Interessen der Anleger und/ oder des verwalteten AIF vermieden wird.
- Die Pflicht zur Offenlegung beinhaltet, die Anleger bereits vor der Ausführung der betroffenen Geschäftsmaßnahme über die allgemeine Art und die Quellen der Interessenkonflikte in Kenntnis zu setzen.
- Die Offenlegungspflicht umfasst auch potentielle Interessenkonflikte, die im Zusammenhang mit der Delegation/Auslagerung oder Subdelegation von Tätigkeiten auftreten können.
- Offenzulegen sind ferner jegliche Geschäfte zwischen einer der in § 2 genannten Person oder zwischen eng verbundenen Unternehmen oder Personen, die über ein direktes oder indirektes Kontrollverhältnis mit der KVG verbunden sind, im Zusammenhang mit einem verwalteten AIF.
- Die Offenlegung erfolgt durch Veröffentlichung auf der Internetseite der KVG oder einem anderen Medium, welches für die relevanten Adressaten zugänglich ist. Hierzu hat die KVG
- die Adresse der Internetseite den Anlegern gegenüber bekannt zu machen und durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass der Anleger davon auch Kenntnis nehmen kann,
- die auf der Internetseite eingestellten Informationen fortlaufend zu aktualisieren,
- sicherzustellen, dass die auf der Internetseite hinterlegten Informationen für die Anleger immer zugänglich sind.
§ 10 Maßnahmen bei Verstößen gegen die Richtlinie
- Die Geschäftsleitung der KVG hat bei einem Verstoß gegen diese Interessenkonfliktmanagement-Richtlinie unverzüglich die Ursache bzw. die Schwachstelle im Arbeits- bzw. Ablaufprozess, die zu diesem Verstoß geführt hat, zu ermitteln und zu beseitigen.
- Ein Verstoß gegen diese Interessenkonfliktmanagement-Richtlinie gilt als Pflichtverletzung und kann zu disziplinarischen Maßnahmen, in schweren Fällen auch zu einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses, führen.
- Über einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Richtlinie ist die zuständige Aufsichtsbehörde zu informieren.
§ 11 Weiterentwicklung der Richtlinie
- Die Geschäftsleitung der KVG ist für die fortlaufende Weiterentwicklung und Pflege der Interessenkonfliktmanagement-Richtlinie verantwortlich; insbesondere wird die Geschäftsleitung erforderliche und angemessene Änderungen und/oder Ergänzungen beschließen und vornehmen lassen.
- Die fortlaufende Information der Mitarbeiter über sämtliche Änderungen und Ergänzungen dieser Richtlinie obliegt dem Interessenkonflikt-Beauftragten. Er macht die Geschäftsleitung auf notwendige Aktualisierungen der Richtlinie aufmerksam.
Transparenz bei der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale und bei nachhaltigen Investitionen auf Internetseiten
Gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzsektor ist die AIF Kapitalverwaltungs-AG nach Art. 10 der Offenlegungs-Verordnung verpflichtet, bei Finanzprodukten im Sinne Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung Transparenz bei der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale und bei nachhaltigen Investitionen zu schaffen.
Die entsprechenden nach Art. 10 der Offenlegungs-Verordnung zu veröffentlichten Informationen können für den Fonds „AIF Lebensquartiere I“ im Folgenden entnommen werden.
Beschreibung der ökologischen und sozialen Merkmale
Die Anlagestrategie des AIF berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale, wobei der Fokus auf Umweltaspekten („Environmental“) liegt.
Die Gesellschaft investiert nach einer Anlaufphase von 4 Jahren nach Fondsauflage fortlaufend mindestens 60 % der vermietbaren Fläche aller Immobilien des Sondervermögens in Immobilien, welche von der Gesellschaft für das Sondervermögen festgelegten ökologischen und sozialen Merkmale erfüllen („Investitionsquote“).
Bei der Auswahl von geeigneten Immobilien im Ankaufsprozess und während der gesamten Haltedauer wird zur Abbildung und Messung der definierten ökologischen und sozialen Merkmale ein Scoring verwendet, welches aus insgesamt 2 verbindlichen Kriterien („verbindliche Kriterien“) und insgesamt 14 optionalen Kriterien („optionale Kriterien“) für die Bereiche „Environmental“ und „Social“ besteht.
Um in die vorstehend definierte Investitionsquote des AIF zu fallen, muss eine Immobilie kumulativ alle verbindlichen und mindestens 50 % der optionalen Kriterien erfüllen.
Im Folgenden werden die Kriterien näher erläutert und definiert:
Verbindliche Kriterien
- Das Investitionsobjekt ist nicht an der Gewinnung, Entnahme, Lagerung, Fertigung oder dem Transport von fossilen Brennstoffen beteiligt
Weder das Gebäude noch das Grundstück an sich darf an der Gewinnung, Entnahme, Lagerung, Fertigung oder dem Transport von fossilen Brennstoffen unmittelbar beteiligt sein. Das bedeutet, dass bspw. keine Tankstellen auf dem Gelände stehen dürfen oder anderweitige Gebäude, die einem solchen Zweck dienen. Des Weiteren sind entsprechende Lagerstätten ebenfalls ausgeschlossen, ausgenommen hiervon sind jedoch Öltanks zur Abdeckung einer Spitzenleistung. Mieter, deren Geschäftszweck in Verbindung mit der Gewinnung, Entnahme, Lagerung, Fertigung oder dem Transport von fossilen Brennstoffen steht, sind nicht ausgeschlossen, es sei denn, die Mietfläche wird für die oben genannte Tätigkeit unmittelbar verwendet.
- Das Investitionsobjekt besitzt bei einer Fertigstellung vor dem 31.12.2020 einen Energieausweis min. C oder besser, bei einer Fertigstellung nach dem 31.12.2020 muss der Primärenergiebedarf unter nZEB liegen
Sollte das Investitionsobjekt vor dem 31.12.2020 fertiggestellt sein, ist ein Energieausweis von min. C erforderlich, bei einer Fertigstellung nach dem 31.12.2020 muss der Primärenergiebedarf unter nZEB-Standard liegen. Dies entspricht einem Primärenergiebedarf von max. 40 kWh/m² pro Jahr. Nachzuweisen ist dies durch einen entsprechenden Energieausweis, welcher von einem externen Gutachter erstellt wurde.
Optionale Kriterien
Environmental
- Vorhandensein eines Smart-Meter-Konzepts
Um die Treibhausgasemissionen eines Gebäudes korrekt zu messen, wird ein intelligentes Zählerkonzept benötigt. Die sogenannten Scope 1 Treibhausgasemissionen beziehen sich auf alle direkt vom Gebäude verursachten Emissionen, also insbesondere durch das Heizen. Dies kann durch entsprechende Wärmemengenzähler gemessen werden, in Kombination mit dem jeweiligen Energieträger, der hierfür verwendet wird.
Die Scope 2 Emissionen schließen darüber hinaus die durch den Stromverbrauch der Immobilie entstehenden Emissionen mit ein. Diese müssen durch sogenannte „Smart Meter“, also intelligente Stromzähler gemessen werden. Das genannte Kriterium gilt somit als erfüllt, wenn das Investitionsobjekt mit entsprechenden Messzählern ausgestattet ist, mit denen sich die Scope 1 & Scope 2 Emissionen messen lassen, also der Verbrauch der Heizung und der Stromverbrauch auf allen Mietflächen.
- Regenwassernutzung oder Regenwasserversickerung auf dem Grundstück
Dieses Kriterium gilt als erfüllt, wenn bauliche Vorrichtungen/Einrichtungen zur Nutzung von Regenwasser zur Verfügung stehen (z.B. Zisternen). Alternativ sollte eine Regenwasserversickerung oder eine Regenwasser Rückhaltung auf dem Grundstück möglich sein (Versickerungsgruben, extensive Dachbegrünung mit Wasserspeicherung).
- Beheizung mit umweltfreundlichen Energieträgern / Heizsystemen
Das Kriterium gilt als erfüllt, wenn die Beheizung des Investitionsobjekts durch einen umweltfreundlichen Energieträger bzw. Heizsystem erfolgt. Hierunter fallen folgende Möglichkeiten:
- Geothermie
- BHKW (Nutzung mit regenerativen oder erneuerbaren Energieträgern wie Biogas, Pflanzenöle, Holzhackschnitzel oder Holzpellets)
- Nah- / Fernwärme
- Pelletheizung
- Wärmepumpe
Entscheidend für dieses Kriterium ist, dass keine fossilen Brennstoffe wie Diesel, Heizöl, Erdgas oder Flüssiggas im Investitionsobjekt zur Beheizung genutzt werden.
- Erzeugung von Strom aus regenerativen/erneuerbaren Energien am Standort
Das Kriterium gilt als erfüllt, wenn am Standort des Investitionsobjekts Strom aus regenerativen oder erneuerbaren Energieträgern erzeugt wird. Neben der Stromgewinnung durch Solar-/Photovoltaikanlagen, die auf min. 40% der hierfür geeigneten Dachflächen vorhanden sein muss, definieren wir regenerative oder erneuerbare Energieträger auch als BHKW-Anlagen, die mit regenerativen Energiequellen genutzt werden, also mit Biogas, Pflanzenölen, Holzhackschnitzel oder Holzpellets. BHKW-Anlagen, die mit fossilen Brennstoffen wie Diesel, Heizöl, Erdgas oder Flüssiggas betrieben werden, fallen nicht darunter. Als dritte Möglichkeit sehen wir die Stromerzeugung durch eine Brennstoffzellenheizung.
- Mehr als 20% der Grundstücksfläche ist begrünt
Das Kriterium ist erfüllt, wenn mindestens 20% der Grundstücksfläche des Investitionsobjekts begrünt ist. Hierzu zählen auch Fassadenbepflanzungen und intensive/extensive Dachbegrünung. Die Erfüllungsquote dieses Kriteriums wird anhand der begrünten Grundstücksfläche im Verhältnis zur gesamten Grundstücksfläche berechnet. Eine vertikale Fassadenbepflanzung ist hierbei gleichzusetzen mit einer begrünten Grundstücksfläche.
- Ladestationen für E-Autos / E-Bikes vorhanden
Das Kriterium gilt als erfüllt, wenn sich im Investitionsobjekt pro 10 Wohneinheiten mindestens eine Ladestation / Lademöglichkeit für E-Autos / E-Bikes befindet.
- Energetischer Standard min. KfW 55
Der durchschnittliche Jahresprimärenergiebedarf eines Investitionsobjekts darf bei max. 55% des Wertes eines Referenzhauses liegen. Darüber hinaus darf der Transmissionswärmeverlust im Vergleich zu einem solchen Referenzhaus maximal 70% erreichen. Das Referenzhaus ergibt sich aus der jeweils für das Investitionsobjekt gültigen EnEV bzw. GEG. Diese Werte sind von einem unabhängigen Gutachter durch einen entsprechenden Energieausweis nachzuweisen.
Sozial
- Zugang zu öffentlichem Nahverkehr vorhanden
Das Kriterium gilt als erfüllt, wenn der öffentliche Nahverkehr – Bus, Bahn, U-Bahn, S-Bahn, etc. – fußläufig erreichbar ist. Als fußläufig erreichbar definieren wir einen Umkreis von 500 Meter um das Investitionsobjekt.
- Vorhandensein von Einkaufsmöglichkeiten und/oder Kindertagesstätten/Kindergärten
Das Kriterium gilt als erfüllt, wenn in dem Investitionsobjekt Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs oder eine Kindertagesstätte/Kindergarten vorhanden ist. Bei Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs handelt es sich um Lebensmitteleinzelhandel- und/oder Drogerien.
- >20% der Wohnfläche öffentlich geförderter oder subventionierter Wohnraum
Das Kriterium gilt als erfüllt, wenn mehr als 20% der Wohnfläche im Investitionsobjekt als öffentlich geförderter/preisgebundener oder subventionierter Wohnraum ausgestaltet ist. Öffentlich geförderte/preisgebundene Mietwohnungen sind Wohnungen, die unter Bereitstellung von Fördermitteln aus staatlichen Haushalten oder von Förderbanken (ohne KfW Bank) geschaffen oder modernisiert wurden und deren Belegung und Miethöhe über eine bestimmte Zeit reglementiert sind (Sozialbindung).
Unter „subventioniertem Wohnraum“ verstehen wir Mietwohnungen, die dauerhaft (mindestens 10 Jahre ab Erwerb des Investitionsobjekts) mehr als 5% unterhalb des ortsüblichen Mietspiegels vermietet werden. Die Erfüllungsquote dieses Kriteriums wird anhand der Wohnfläche mit den oben genannten Eigenschaften im Verhältnis zu der Gesamtfläche des Investitionsobjekts berechnet.
- >20% der Wohnungen sind barrierefrei
Das Kriterium gilt als erfüllt, wenn mehr als 20% der Wohnungen im Investitionsobjekt barrierefrei sind. Barrierefreiheit definieren wir gemäß der jeweils gültigen Landesbauordnung für Wohnungen in Verbindung mit der jeweiligen Verwaltungsvorschrift „technische Baubestimmung“. Die jeweils heranzuziehenden Landesbauordnungen richten sich nach dem jeweiligen Bundesland und dem Baujahr des Investitionsobjekts. Die Erfüllungsquote wird anhand der Anzahl der barrierefreien Wohnungen im Verhältnis zu der Gesamtanzahl der Wohnungen in dem zu erwerbenden Investitionsobjekt berechnet.
- Ausreichende Anzahl an witterungsgeschützten und gesicherten Fahrradstellplätzen vorhanden
Das Kriterium gilt als erfüllt, wenn pro Wohneinheit mindestens 20% mehr Fahrradstellplätze vorhanden sind, als in der jeweiligen Landesbauverordnung in der für das Baujahr gültigen Fassung vorgeschrieben sind. Diese Stellplätze müssen witterungsgeschützt und gesichert sein, das heißt, es muss eine Überdachung für die Stellplätze vorhanden sein, sofern sich diese außerhalb des Gebäudes befinden und es muss die Möglichkeit gegeben sein, die Fahrräder abzuschließen und damit zu sichern. Als Wohneinheit definieren wir jede separate Mietwohnung in der Immobilie. Mietflächen mit einer anderen Nutzung wie bspw. Einzelhandel oder Büro fließen nicht in die Berechnung mit ein.
- Spielplatz oberhalb gesetzlicher Anforderung vorhanden
Das Kriterium gilt als erfüllt, wenn der zum Investitionsobjekt gehörende Spielplatz die Anforderungen an die Fläche des Spielplatzes, welche sich aus der jeweiligen Landesbauverordnung in der für das Baujahr gültigen Fassung ergibt, um mehr als 10% überschreitet.
- Bike-Sharing-Angebot oder Fahrrad-Reparaturangebot vorhanden
Das Kriterium ist erfüllt, wenn das Investitionsobjekt über mindestens 2 Fahrräder pro 50 Wohnungen verfügt, die im Rahmen eines Bike-Sharing-Angebots durch die Mieter genutzt werden können oder alternativ eine Reparaturstation im Objekt vorhanden ist, durch die die Mieter deren eigene Fahrräder instandhalten und reparieren können.
Monitoring der ökologischen und sozialen Kriterien
Der AIF wird die Einhaltung der dargestellten ökologischen und sozialen Merkmale für die zu erwerbenden Investitionsobjekte im Rahmen des Ankaufsprozesses und fortlaufend über die gesamte Haltedauer der Investitionsobjekte einmal jährlich prüfen. Auf diese Weise stellt die Gesellschaft sicher, dass die definierten ökologischen und sozialen Kriterien in dem in den Anlagebedingungen definierten Maße fortlaufend eingehalten werden. Die Berichterstattung erfolgt in einem entsprechenden Reporting an die Anleger bzw. der Jahresberichterstattung des AIF.
Bei der Auswahl von geeigneten Immobilien im Ankaufsprozess und während der gesamten Haltedauer wird zur Abbildung und Messung der definierten ökologischen und sozialen Merkmale ein Scoring verwendet, welches aus insgesamt 2 verbindlichen Kriterien („verbindliche Kriterien“) und insgesamt 14 optionalen Kriterien („optionale Kriterien“) für die Bereiche „Environmental“ und „Social“ besteht.
Um in die vorstehend definierte Investitionsquote des AIF zu fallen, muss eine Immobilie kumulativ alle verbindlichen und mindestens 50 % der optionalen Kriterien erfüllen.
Sollte ein Investitionsobjekt im Laufe der Haltedauer die definierte Investitionsquote nicht mehr erfüllen, werden rechtzeitig entsprechende Maßnahmen ergriffen, um eine Einhaltung der ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Sollte dies, bspw. aus ökonomischen Gründen, nicht möglich sein, wird die Gesellschaft weitere strategische Handlungsoptionen prüfen, die ggf. auch eine Desinvestition bedeuten können.